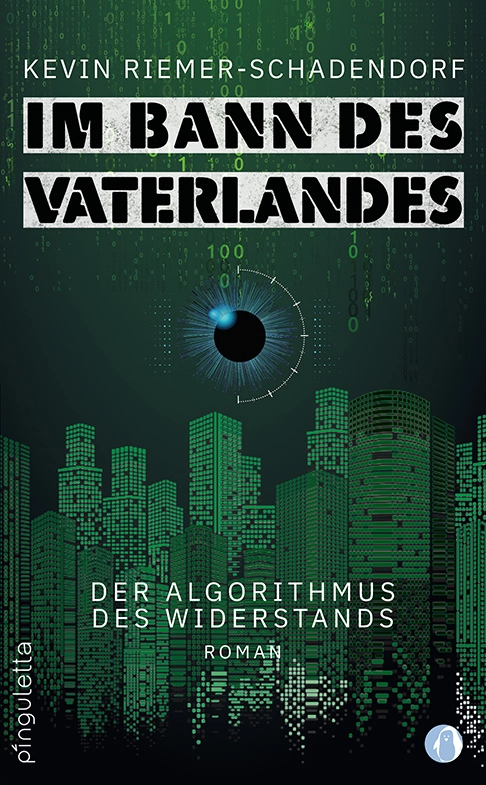Der Autor
im Interview.
Herr Riemer-Schadendorf, Ihr Roman entwirft eine beängstigend plausible Zukunft. Wie viel davon ist reine Fiktion – und wie viel ist aus Ihrer Sicht bereits Gegenwart?
Literarisch gesehen ist es größtenteils noch Fiktion – kritisch betrachtet eher eine realistische Fortschreibung. Ich habe lediglich die Logik heutiger Entwicklungen konsequent zu Ende gedacht: politische Polarisierung, technologische Dominanz, schleichender Demokratieabbau. Wer genau hinhört, merkt, dass die Zukunft schon anklopft.
Sie lassen eine Ihrer Figuren sagen: „Der gleiche Rassismus – nur weichgezeichnet. Wie ein Fotofilter – nur eben für Texte.“ Was hat Sie dazu bewogen, diese Form der KI-Kritik so pointiert ins Zentrum zu stellen?
Wir haben uns zu sehr daran gewöhnt, dass Algorithmen neutrale Werkzeuge sind. Dabei sind sie längst semantische Designer. Die Gefahr besteht nicht nur in offensichtlicher Propaganda, sondern im schleichenden Umbau der Sprache. Wer kontrolliert, wie wir sprechen, beeinflusst, wie wir denken. Entsprechend auch, wie wir unsere eigene Geschichte bewerten und unsere Zukunft gestalten. Oder wie Orwell es treffend formulierte: „Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.“
In Ihrem Roman übernehmen KI-Systeme die redaktionelle Arbeit – bis hin zur „individualisierten Wahrheit“. Ist das Science-Fiction oder bittere Satire?
Weder noch. Es ist meines Erachtens ein durchaus realistisches Szenario – nur leicht überspitzt. Wenn Leser:innen automatisch auf ihre Zielgruppe zugeschnittene Artikel erhalten, verliert die Öffentlichkeit ihren gemeinsamen Referenzrahmen. Jeder lebt dann in seiner algorithmischen Echokammer – nur ohne es zu merken.
Die KI verzerrt jedoch nicht nur die Wahrheit in den Medien, sondern dient auch der Überwachung. Hier sind wir nahe an Ihrem Orwell-Zitat und seinem Roman 1984. Ihr Roman beschreibt in diesem Kontext eine Gesellschaft, in der eine KI-gesteuerte Überwachung bis in die kleinsten Bewegungen reicht – biometrische Zugangskontrollen, die Analyse von Netzaktivität, selbst Gesundheitsdaten werden automatisiert erfasst. Ist das Zukunft oder bereits stille Gegenwart?
Das ist teilweise bereits Gegenwart – nur in der Sprache der Zukunft erzählt. Wir haben längst akzeptiert, dass unsere Geräte uns zuhören, unsere Kameras uns erkennen und unsere Daten wie Handelsware zirkulieren. Was in meinem Roman „Iris“ heißt, trägt im heutigen Alltag Namen wie Siri oder Alexa. Der Unterschied ist: Im Buch ist die Kontrolle sichtbar – in der Realität ist sie meist bequem. Und genau das macht sie so gefährlich.
Die Künstliche Intelligenz in Ihrem Roman wirkt nicht wie ein Werkzeug, sondern wie ein politischer Akteur – sie entscheidet, wer gehört wird, wer auffällt, wer verschwindet. Ist das eine Metapher oder eine Warnung?
Beides. Eine Metapher für Systeme, die sich der Kontrolle entziehen, und eine Warnung davor, dass wir Entscheidungen immer häufiger an Maschinen delegieren, deren Logik wir weder in Gänze verstehen noch hinterfragen. Wenn Algorithmen zum Richter über Meinungen, Narrative oder sogar Identitäten werden, endet das, was wir Öffentlichkeit nennen. Das ist kein technisches, sondern ein zutiefst demokratisches Problem.
Die Figur Micha Rebesky, ein Journalist mit moralischem Rückgrat, wirkt in dieser Welt zunehmend deplatziert. Ist er ein Alter Ego?
In gewisser Weise ja; auch wenn ich selbst kein Journalist bin – er ist das schlechte Gewissen vieler, mich eingeschlossen. Micha hadert, er zweifelt, er rebelliert, manchmal zu spät. Ich wollte keinen strahlenden Helden, sondern jemanden, der stolpert – und sich trotzdem immer wieder aufrichtet.
In einer Szene sagt Rebesky: „Die Zeiten des Homo sapiens sind vorbei. Wir sind eher so etwas wie ein Homo sentiens, der der KI die notwendigen Emotionen verleiht.“ Ist das Ihre Gesellschaftsdiagnose?
Ich würde eher sagen: ein Weckruf. Unsere größte Stärke – Empathie, Selbstreflexion, kritisches Denken – wird zunehmend ausgelagert. KI ist nicht das Problem. Vielmehr ist es unsere Gleichgültigkeit gegenüber ihrer politischen Instrumentalisierung. Wer nur noch „fühlt“, aber nicht mehr „versteht“, wird manipulierbar.
Es ist offensichtlich, dass Sie mit dem Roman auch ein politisches Statement setzen. War das von Anfang an Ihr Ziel?
Ich wollte kein Thesenpapier schreiben, sondern eine Geschichte. Aber ja – Literatur darf und soll sich einmischen. Die Entwicklung in Deutschland, wie ich sie beobachte, macht mir Sorgen. Und ein Roman hat den Vorteil, dass er weniger belehrt, sondern vielmehr infrage stellt – und genau das brauchen wir dringend: Kritik an den politischen Entwicklungen. Primär Kritik an Politiker:innen, die auf populistische Meinungen und alternative Fakten setzen, anstatt auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Warum solch einer plumpen Meinungsmacherei in der Realität immer wieder eine mediale Bühne gegeben wird, bleibt mir ein Rätsel. Und wenn Sender ihnen dennoch eine Plattform bieten; wie leicht ließen sich solch populistische Aussagen konsequent durch einen Live-Faktencheck entlarven.
Trotz aller medialer Düsternis gibt es Momente des Widerstands. Menschen, die Haltung zeigen, sogar Liebe inmitten der Überwachung. Ist das die Botschaft?
Der Roman enthält nicht die eine zentrale Botschaft. Doch sie liefert Hoffnung. Hoffnung ist eine Frage der Entscheidung. Rebesky flüchtet sich nicht ins Pathos, sondern ins Handeln – manchmal zögerlich, manchmal ungeschickt, aber nie zynisch. Diese Form des zivilen Ungehorsams auf leisen Sohlen halte ich für besonders wirkungsvoll.
Was wünschen Sie sich von Ihren Leserinnen und Lesern – abgesehen davon, dass sie Ihr Buch kaufen?
Dass sie anfangen, zwischen den Zeilen zu lesen – nicht nur in Romanen, sondern auch im Alltag. Dass sie wach bleiben, wo andere abschalten. Und dass sie begreifen: Demokratie stirbt nicht an einem Tag, sondern schleichend in Form von Routine und Bequemlichkeit. Adorno hat es auf den Punkt gebracht: “Ich fürchte nicht die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten.”